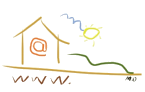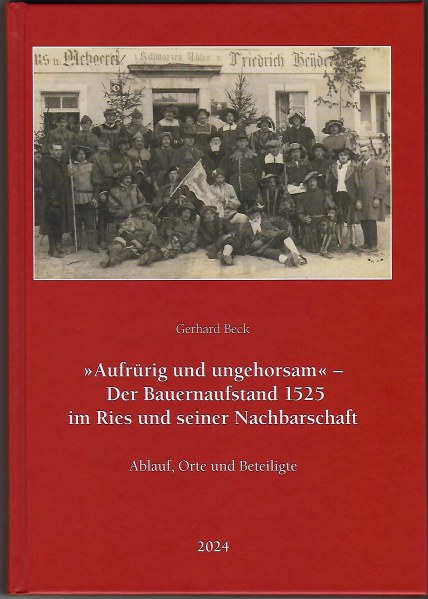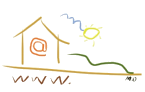Gerhard Beck
Auch viele Kesseltaler Bauern waren beim Aufstand dabei
Gerhard Beck referierte in Bissingen über den Bauernkrieg von 1525
Bissingen (HER). Geschichtliche Ereignisse, auch wenn sie sich schon vor 500 Jahren ereignet haben, vermögen die Menschen zu faszinieren. Das bestätigte der Vortrag des Rieser Heimatforschers und Archivars Gerhard Beck zum Thema „Der Bauernaufstand 1525 im Südries und Kesseltal“ im Rahmen der diesjährigen Dillinger Kulturtage.
Mehr als 150 Besucherinnen und Besucher konnte Helmut Herreiner, Kreisarchivpfleger des Landkreises Dillingen und Archivbetreuer in seiner Heimatgemeinde Bissingen, im Saal des Gasthauses Krone in Bissingen willkommen heißen. Unter ihnen waren auch Bürgermeister Stephan Herreiner, Bezirksrat Ulrich Reiner, Wolfgang Neudert als Vertreter der Raiffeisenbanken und Volksbanken im Landkreis Dillingen sowie Armin Dauser, Schatzmeister des Vereins „DLG – Kultur und Wir e.V.“
Ihnen allen wurde an diesem Abend bewusst, wie tief die weltliche und geistliche Obrigkeit vor 500 Jahren in das Leben der einfachen Leute eingriff und wie hart die Lebendbedingungen für die Bauern damals waren. Leibeigenschaft, das vermag man sich heute in unserer freiheitsliebenden Gesellschaft kaum mehr vorzustellen.
Gerhard Beck erzählte, unterstützt von einer Bildpräsentation, anschaulich davon, wie sich zu Beginn des Jahre 1525 revolutionäre Gedanken von Oberschwaben her verbreitet hatten. Vor allem von den unterdrückten Bauern wurden Freiheitsrechte, die Verringerung der drückenden Abgabenlast und kirchliche Reformen gefordert. Im Frühjahr 1525 war daher auch das Ries in Aufruhr. Die frühe demokratische Bewegung erreichte hier mit dem sogenannten Deininger Haufen Ende März einen ersten Höhepunkt.
Und hier waren auch zahlreiche Bauern aus dem Kesseltal mit von der Partie, wie Gerhard Beck vor allen Dingen bei seinen Forschungen im Fürstlich Wallersteinschen Archiv auf der Harburg herausfand. Insgesamt rund 350 Bauern aus den Dörfern von Bollstadt und Forheim bis hinunter rund um Bissingen und hinüber nach Rohrbach, Schaffhausen, Mauren und Spielberg waren es, die den Deininger Haufen verstärkten. Alleine aus Amerdingen sind 56 Bauern genannt. Aus Bissingen und den umliegenden Dörfern werden 20 „aufrürerische Personen“, wie es heißt, genannt, unter ihnen Martin Jall und Hans Krapfenbauer, Hans Lindemaier aus Göllingen, Leonhard Begkh aus Stillnau, ein „Mayr zu Thalheim“ oder ein „Peter zu Unterbissingen“. Mehr Freiheit und weniger Willkür, eine vernünftige Lebensgrundlage für sich selbst und für ihre Familien sowie Rechte zurück, die einst noch im Mittelalter selbstverständlich für die bäuerliche Landbevölkerung waren und die von den Adligen und den kirchlichen Oberen immer mehr an sich gerissen worden waren, das waren die Ziele der Bauernhaufen überall in Süddeutschland, vom Elsaß bis hinauf nach Thüringen.
In der Schreibstube der Bauern des Deininger Haufens war der örtliche Pfarrer Stefan Wolf tätig. Es gingen Briefe an die benachbarten Städte und Dörfer sowie an andere Bauernhaufen mit der Bitte um Unterstützung. In der Folge strömten weitere Aufständische aus allen Himmelsrichtungen hinzu. Schließlich lagerten mehrere Tausend Bauern aus über 100 Ortschaften bei Deiningen auf den Feldern. Die 24 ernannten Bauernräte, unter ihnen auch Ludwig Herger aus Mönchsdeggingen, entstammten meist der großbäuerlichen Schicht. Die Forderungen der Bauern wurden mit Abgesandten der Grafen von Oettingen und des Schwäbischen Bundes am 7. April in der Aumühle bei Löpsingen verhandelt. Mit Versprechungen, aber auch mit der Androhung von militärischer Gewalt wurden die Revolutionäre am 12. April zur friedlichen Auflösung des Haufens bewogen. Die meisten von ihnen wurden mit Strafzahlungen zur Rechenschaft gezogen und mussten eine sogenannte „Urfehde“, vergleichbar einer modernen Bewährungsstrafe, leisten.
Viele wurden auch eingesperrt, aber im Gegensatz zu Tausenden von Bauern, die etwa in den blutigen Schlachten bei Leipheim oder bei Leubas im Allgäu ums Leben kamen, ging es für die Mehrzahl der aufständischen Südrieser und Kesseltaler Bauern vergleichsweise glimpflich ab. Vielleicht auch, weil ihre Herrschaften von ihnen und ihren Höfen und Sölden auch weiterhin die gewohnten Steuern und Abgaben erhalten wollten. Und doch, auch im Ries gärte es auch nach dem 12. April 1525 weiter und es kam zu einer Reihe von Gewaltexzessen, bei denen später die Klöster Mönchsroth, Maihingen und Aufhausen geplündert wurden, ehe schließlich am 7. Mai 1525 ein 8000 Mann starkes Bauernheer in der Schlacht bei Ostheim von einer kleinen, aber gut ausgerüsteten Truppe des ansbachischen Markgrafen vernichtend geschlagen wurde.
Auch hier waren noch einige wenige Südrieser Bauern dabei, darunter die Degginger Bauern Hanns Rorbacher, Franz Wagner, Hanns Schott, Caspar Winter, Balthas Sauer und andere mehr. Der schon erwähnte Bauernhauptmann Ludwig Herger musste nach seiner Gefangennahme und langen Haft am 2. Juni 1526 Urfehde gegen seinen Herrn, Graf Carl Wolfgang zu Oettingen, leisten. Das Ende des Bauernkrieges im und um das Ries erfolgte am 17. Mai in Ellwangen mit der Niederschlagung der Aufstände.
Und doch hatten die beteiligten Bauern ein Zeichen für Freiheit und für das gesetzt, was man heute als „demokratische Rechte“ bezeichnet. Unter großem Beifall dankten Helmut Herreiner und Armin Dauser für den Verein „DLG – Kultur und Wir“ dem Referenten Gerhard Beck für seinen lebendigen Vortrag, der mehr als nur ein Schlaglicht auf die bemerkenswerten Ereignisse vor 500 Jahren warf.
Helmut Herreiner